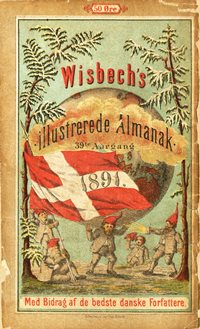Von der Nordseeküste
Text zu Bildern von Carl Locher und Christian Mølsted
Es gibt bekanntlich wenige Orte auf der Welt, wo jährlich so viele Schiffe zu Grunde gehen wie an der jütländischen Westküste. Vom Westwind verschlagen oder in Nebel und Dickicht gehüllt treiben die Hilflosen von draußen auf der Nordsee hierher, werden gegen den Sand geworfen und dort von der Brandung jämmerlich zerbrochen.
Tausende von Seefahrern haben hier ihr Grab gefunden und – trotz all der vielen philanthropischen Maßnahmen der Neuzeit wie Leuchttürmen, Seezeichen und dergleichen – trägt der menschenleere, völlig raue Strand weiterhin den treffenden Namen "Friedhof der Schiffe".
Dieser Friedhof hatte in alten Zeiten seine ganz eigenen Leichenräuber. Das waren die Bewohner des Küstenlands – ein halbwilder Menschenschlag –, die in kleinen Ansammlungen von geteerten Holzhütten hinter den nackten Dünen lebten und sich Tag für Tag friedlich vom Fischfang auf dem Meer ernährten. Aber wenn die Stürme losbrachen, wenn der Nebel den Strand umhüllte, erwachten unheimliche Leidenschaften in ihrer Brust. Dann lagen sie regungslos auf den Dünen und lauschten dem dumpfen Dröhnen des Meeres mit einem gierigen Blitzen in den zu Schlitzen verengten Augen – wie lauernde Schakale, die den Überlebenskampf erahnen und Beute wittern. Wehe dann den Unglücklichen, die dort draußen umhertrieben! Keine helfende Hand wurde ihnen in ihrer Not gereicht; keiner gab Antwort auf ihre Jammerschreie. Und retteten sie sich schließlich aus eigener Kraft sicher an Land, waren ein Messer in der Seite und ein Stiefel ins Gesicht der Willkommensgruß, der sie erwartete. Und während die Brandung die Fetzen des zerrissenen Schiffes und dessen Ladung wie Raubgut an den Strand warf, wurden die geschändeten Leichen in dem stillschweigenden Dünensand begraben – und jegliche Erinnerung an die blutige Tat war erloschen.
Diese Strandungen spielen immer noch eine nicht unwesentliche Rolle im Leben der Nordseefischer. Eine "gute" Strandung kann einem fehlgeschlagenen Fischzug einiges abhelfen und der Jahresertrag wird an vielen Orten noch ebenso an der Menge und dem Wert der Strandungen wie an dem Erfolg beim Fischfang gemessen.
Aber nun sind – so wie die Dünen selbst – auch diese Bevölkerung und ihre Lebensweise unter das Joch der Zivilisation geraten. Entlang der gesamten Küste – vielerorts mit nur wenigen Meilen Abstand – befinden sich nun Rettungsstationen, die der Staat errichtet hat, und die unter hohen Kosten mit klug konstruierten Rettungsbooten, Raketenapparaten zum Start von Rettungsseilen und dergleichen, an erster Stelle aber mit einer festangestellten, gut organisierten und hervorragend eingeübten Mannschaft ausgestattet wurden, ausgewählt aus den tapfersten, stärksten und verlässlichsten Bewohnern der Küste. Mit einem Mut und einer Unerschütterlichkeit, die Bewunderung hervorrufen mögen, verlassen diese Männer Haus und Hof, sobald das Notsignal ruft, und setzen in der Brandung oft das eigene Leben aufs Spiel, um schiffsbrüchige Kameraden zu retten, die sie nicht kennen, ja, deren Sprache sie meistens nicht einmal verstehen.
Diese Art von Strandungen bereichern die Fischer hier mittlerweile nicht mehr. Im Gegenteil. Als Bezahlung für die beschwerliche und gefahrvolle Arbeit erhält die Rettungsmannschaft nur sehr wenige Kronen. Das Wrack des verlassenen Schiffes und der Teil der Ladung, die später geborgen werden kann, gehört den Versicherungskaufmännern und wird unter staatlicher Kontrolle verkauft. Nur, wenn Schiffe bei ruhigem Wetter – wegen Nebel oder Unachtsamkeit – auf den Sandgrund laufen und Beistand benötigen, um loszukommen, erhalten die Fischer die Gelegenheit auf einen ansehnlicheren Zusatzverdienst. Wenn kein Menschenleben, sondern nur der Wert des Schiffes auf dem Spiel steht, müssen oft beträchtliche Summen Lösegeld bezahlt werden, und von diesen kommt den Fischern stets ein Drittel zugute, obwohl ein herbeigerufener Bergungsdampfer die eigentliche Arbeit verrichtet.
Der Grund, auf den die Schiffe laufen, sind die sogenannten Riffe – lange, feste, unter Wasser gelegene Sandbänke, von denen drei oder vier genau der Küstenlinie folgen, und die sich selbst bei Windstille dadurch zu erkennen geben, dass die See über ihnen "bricht". Sogar über der Krone der äußersten Reihe stehen mehr als sechzehn Fuß Wasser.
Das erste Riff, also jenes, welches der Küste am nächsten ist, wird von dieser durch nur wenige Ellen flaches Gewässer getrennt und liegt bei östlichem Wind ganz sichtbar über der Wasseroberfläche. Über dem zweiten Riff stehen für gewöhnlich circa zehn Fuß Wasser, und meistens kommen auf dieser Sandbank größere Schiffe auf, nachdem sie die Brandung unversehrt über den äußeren Meeresgrund gehoben hat. Aber auch über das zweite Riff können die Schiffe bei stürmischer See geschleudert werden, selbst wenn sie bereits "auf Grund gelaufen" sind, und diese finden dann über dem ersten Riff ihren Untergang. Nur bei einem Orkan oder wenn die Schiffe sehr klein sind, führt die See sie auch herüber und zerschlägt sie dann an dem Strand.
*
Es war ein Tag im Spätherbst. Gegen Abend hatten wir als Gesellschaft von vier Personen eins der kleinen Fischerdörfer erreicht, die sich hinter der Dünenreihe verstecken, – zerzaust und durchgefroren nach einer achtstündigen Fahrt entlang des Nordseestrands. Es hatte vier Tage lang heftigen Wind gegeben, und dieser war zuletzt zu einem starken Sturm herangewachsen, der die See in Aufruhr versetzt hatte, sodass wir auf dem letzten Stück Weg von diesem Donnern ganz taub geworden waren.
Nun saßen wir in dem kleinen Gasthof zusammen mit ein paar Einheimischen gemütlich um einen warmen Grog. Natürlich kamen wir bald auf die letzte Strandung zu sprechen. Der Vormann der Rettungsmannschaft, eine drei Ellen große und entsprechend breite Wildengestalt mit einem rotbraunen Bart bis zum vierten Westenknopf hinunter, erzählte darüber ungefähr Folgendes:
Neujahrsabend. Es tobte ein gewaltiger Sturm mit dichtem Schneegestöber und beißendem Frost, sodass die See bis hoch zu den Dünen reichte und wie Glasscherben klang. Bei Sonnenuntergang hatte der Vormann Aussicht gehalten und daraufhin – wie es das Gesetz befiehlt – Nachtwache über den Strand angeordnet. Um neun Uhr war er zu Bett gegangen. Doch kaum hatte er eine Stunde lang geschlummert – richtig schlafen konnte er bei einem solchen Wetter nie – als es an seiner Fensterscheibe klopfte. "Eine Strandung?", fragte er. – "Ja", antwortete die raue Stimme der Nachtwache. – "Wo?" – "Nøderenden. Ich hör die Leute schreien." – Der Vormann weckte seine Frau auf, die hastig einen Schluck Kaffee aufwärmte, während er selbst das Ölzeug anzog, den Südwester unter dem Kinn zusammenschnürte und die Laterne zum Brennen brachte. Aber das Licht wurde vom Sturm in demselben Augenblick gelöscht, als er aus dem Haus trat. Es war so rabenschwarz, dass er nur die weißen Schneepünktchen erkennen konnte, die an seinen Augen vorbeisausten, und die Kälte war so eisig, dass sich beinahe augenblicklich lange Eiszapfen an seinem Bart bildeten. Mit Mühe arbeitete er sich durch den Sturm zum Haus bei den Stranddünen vor, wo sich das Rettungsboot befand und schon mehrere Mitglieder der Mannschaft versammelt standen. Während ein paar von ihnen hierblieben, um das Kommen derer abzuwarten, die hinausfahren mussten, begaben sich die anderen mit den Raketenapparaten stracks zum Ort der Strandung. Obwohl es nach Nøderenden hinaus kaum eine halbe Viertelmeile war, dauerte die Fahrt über zwei Stunden. Sie kämpften sich taumelnd durch Dunkelheit, Sturm und die rauchenden Dünen, bis sie endlich die äußerste erreichten, wo ihnen die See entgegenbrüllte. Sie konnten sich kaum aufrecht gegen den Sturm halten, obwohl sie sich fest beieinander eingehakt hatten. Die gläsern klirrende Brandung war unmittelbar unter ihren Füßen zu hören, und hin und wieder wurden sie von eisigem Schaum bespritzt. Sie sahen die eigene Hand vor Augen nicht, und konnten im ersten Augenblick auch nichts anderes hören als das Toben von Sturm und Wellen (zuerst macht einen die Brandung immer stocktaub, aber nach und nach, sobald man sich an deren Donnern gewöhnt, wird man so hellhörig, dass man schließlich selbst die zarten Töne einer Lerche deutlich durch den Brandungslärm hört). – Es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis die Rettungsmannschaft die heiseren Jammerschreie der Schiffbrüchigen zusammen mit dem Brechen und Krachen von Holz und pfeifendem Kreischen von gerissenen Seilen hörte. Sie versuchten eine Rakete dorthin zu schießen, wo die Schreie herkamen, aber vergebens. Sogar die schwere Kupferpatrone der Rakete warf der Sturm zurück. – Schließlich kam das Rettungsboot an, mit sechs Pferden vorgespannt, die vor Erschöpfung völlig entkräftet und weiß vor lauter Schweißschaum waren. Es war unbegreiflich, dass sie in dieser Dunkelheit überhaupt den Weg durch die Dünen gefunden hatten. Hastig wurde nun das Boot vom Wagen gehoben und hinunter ans Meeresufer geschoben. Doch im selben Augenblick war es, als ob sich die See plötzlich bis zu den Wolken hob. Ein einzelnes, splitterndes Krachen war dicht an Land zu hören; die Schreie verstummten …
Als der Tag anbrach, bot sich ihnen ein trauriger Anblick. Zwischen Maststümmeln und Tauwerk lagen sieben steifgefrorene, wie kandierte Leichen am Strand, wo die Wellen sie angespült hatten. Das zerschlagene Schiff lag mitten in der Brandung auf der Seite. Mit seinem Eispanzer und seinen langen Eiszapfen ähnelte es einem großen Talgtrog1. Die Masten waren fort und das ganze Gut über Bord geschwemmt.
Der Rettungsmannschaft blieb vorläufig nichts anderes zu tun als die Leichen auf den Wagen zu laden. Mit diesen fuhren sie dann wieder zurück ins Dorf.